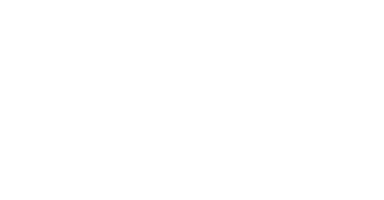Handbuch der therapeutischen Utilisation
Vom Nutzen des Unnützen in Psychotherapie, Kinder und Familientherapie, Heilkunde und Beratung
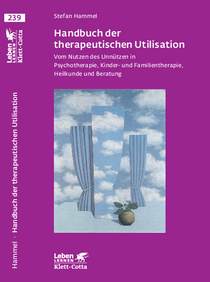
Das Buch enthält auf 285 Seiten Fallbeispiele und Erklärungen dazu, wie man in der Therapie gerade die Dinge für die Ziele der Klienten nutzen kann, die auf den ersten Blick unnütz, lästig oder geradezu schädlich erscheinen. Dazu gehören natürlich gerade die Probleme, deretwegen die Leute in Therapie gekommen sind, zum anderen aber auch die Berufe, Hobbies und Lebenserfahrungen der Menschen und schließlich ganz alltägliche Dinge wie der Atem, Kirchenglocken, ein Handyklingeln oder Handwerkerlärm.
Der Kern des Buches besteht aus über 60 kurzen Fallgeschichten aus der Beratungs- und Therapiearbeit, die auf die Fragen hin untersucht werden: Was aus dem Leben der Klienten und was von ihren Problemen oder Symptomen (oder auch was von der aktuellen Beratungssituation) wird in der Therapie jeweils genutzt, um zu Lösungen zu kommen. Und wie geht das? Was wirkt befreiend an der Therapie? Und wie kann die Therapie so individualisiert werden, damit die Beratung so einzigartig wird, wie die Klienten und ihre Lebensgeschichten es sind? Das Buch bietet eine Vielzahl verblüffender Perspektiven und eröffnet neue Möglichkeiten, um die Therapie noch wirksamer und nachhaltiger zu gestalten.
HIER können Sie das Buch im Online Shop bestellen!
Rezensionen aus der Fachwelt:
Peter Stimpfle, Eichstätt:
Stefan Hammel hat sich mit seinem „Handbuch der therapeutischen Utilisation“ die Mühe gemacht, ein zentrales Thema der Hypnotherapie für die allgemeine Beratung und Psychotherapie gut verständlich herauszuarbeiten. Das von Milton Erickson postulierte Prinzip der Utilisation besagt, dass gerade in der Struktur des Problems eines Klienten das Entwicklungspotential für Lösungen steckt. Das heißt, die Wirksamkeit der Therapie erhöht sich, wenn Elemente des Problems (also der Symptomatik oder allgemein der Ausgangssituation) des Klienten als Entwicklungspotenzial erkannt und ins Zentrum der Behandlung gerückt werden. Simpel und wirksam, jedoch wie setzt man das denn nun im Einzelfall um? Wer heute Hypnotherapie anwendet, weiß, wie hilfreich es sein kann, grundsätzlich bereits im Problem die Lösung zu suchen, bzw. im Unnützen das Nützliche, und wer einer hypnosystemischen Orientierung treu bleiben will, dem ist klar, dass es dafür keine Rezepte geben kann.
Stefan Hammel hat der Versuchung widerstanden, ein „Kochbuch“ zu veröffentlichen, aus dem man Rezepte beziehen könnte, um das „Richtige“ zu tun. Dies ist in einer von Leitlinien und Qualitätsmanagement gequälten Zeit erfrischend. Ausgehend von wissenschaftlichen Befunden, mit einer klaren Struktur und einer Fundgrube von Einzelfallbeispielen zeigt er auf, wie Utilisation praktisch aussehen kann.
Im Fallbeispiel „Polizeiphobie“ illustriert er dies, indem er angstbehaftetes traumatisches Erleben dazu nutzt, dieses in eine Vielzahl von Teilerfahrungen zu zergliedern (Unterscheidung von angstfrei besetzten Polizisten im Gegensatz zu phobisch besetzten Aufsehern) und dadurch Unterscheidungen einführt, wodurch sich ein höherer Grad an Differenzierung des Erlebens ergibt und der Patient lernen kann, „irrelevante“ Teilerfahrungen auszusondern und Trauma-Assoziationen aufzuheben. Im Fallbeispiel „Nach der Welle“ zeigt er, wie die Erfahrung, einen epileptischen Anfall überlebt zu haben, genutzt werden kann, um in der darauf folgenden ruhige Lebensphase Energie für das Überleben des möglicherweise nächsten Anfalls bereitzustellen. Im Fallbeispiel „Vogelphobie“ überlässt er die Übernahme von Verantwortung für die Individualisierung von Anweisungen einer Patientin selbst, um kontrolliert „alle therapeutischen Interventionen so anzupassen, dass sie besser zu ihr passen, als der Therapeut dies hätte“ tun können. Dabei wird sie aufgefordert, „Unbrauchbares gegebenenfalls zu verwerfen, alle Emotionen und imaginierten Sinneswahrnehmungen zu regulieren, den Therapieprozess nach Wunsch zu unterbrechen und bei Bedarf jederzeit eigenständig ihre Ressourcenerfahrungen aufzurufen und wieder zu spüren“. Im Fallbeispiel „Das Leben entquirlen“ wird gezeigt, wie bei einer Patientin mit Borderline-Störung eine lebensbedrohliche Auseinandersetzung mit ihrem Stiefvater und die Deutung der Patientin („selber schuld“) umgedeutet wird (der von ihr als berechtigt angesehener Angriff wird in einen neuen Rahmen gesetzt; „Du hattest Recht, er benimmt sich daneben“).
Diese Beispiele und die Art ihrer Präsentation inspirieren. Stefan Hammel hat einen differenzierten Überblick über Utilisationsmöglichkeiten und -techniken zusammengetragen. Er beginnt systemisch konsequent bei der Auftrags- und Zielklärung, bevor er eine „Brücke vom Problem zur Lösung“ schlägt. Am Beispiel „spezifischer Problemstellungen“ veranschaulicht er, wie Utilisation aussehen könnte, beginnend bei mehr somatischen Symptomen wie Schmerz oder Tinnitus hin zu Symptombereichen wie Angst, Zwang und Depression. Schließlich zeigt er, mit welchen Methoden Utilisation praktisch umgesetzt werden kann. Hier gibt das Buch einen fundierten Überblick. Der Autor legt Beispiele aus unterschiedlichen Praxisfeldern vor, wie man das scheinbar Unnütze nutzen kann. Die Beschreibung von Utilisationstechniken (wie Kopplung, Altersregression, Paradoxe Interventionen, Reframing, Externalisieren, Personifizieren usw.) veranschaulicht dabei das simple und dennoch anspruchsvolle Prinzip der Nutzung des Unnützen. Er stellt dazu sowohl ein theoretisches Gerüst wie auch eine Fülle von Befunden aus unterschiedlichen Beratungs- und Therapiekontexten vor.
Allerdings kann man sich fragen, wo die Grenzen der Utilisation liegen. Ist wirklich alles utilisierbar? Auch wenn Hammel kein Rezeptbuch im Sinne hatte, kann davor gewarnt werden, das Buch als „Rezeptbuch“ zu verstehen und zu missbrauchen. Ein weiteres Missverständnis könnte in der Idee liegen, dass man auf die Würdigung von leidvollen Erfahrungen verzichten könnte, wenn man die Nützlichkeit von Symptomen in den Vordergrund stellt. Wenn Erickson selber beim Thema der Utilisation vage blieb, könnte durch Hammels Ausdifferenzierung gerade dort, wo Struktur und Differenziertheit gewonnen wird, auch etwas verloren gehen – etwa an der wohltuenden Schlichtheit des Ansatzes. Auch wenn man dieses und anderes kritisch einwenden mag, bleibt das Fazit, dass es Stefan Hammel gelungen ist, die schwierige Balance zwischen Wissenschaftlichkeit, Theorie, Empirie und den Bedürfnissen einer vielfältiger werdenden systemisch-hypnotherapeutischen Praxis in einer guten Weise zu halten und ein sehr inspirierendes Buch zu schreiben.